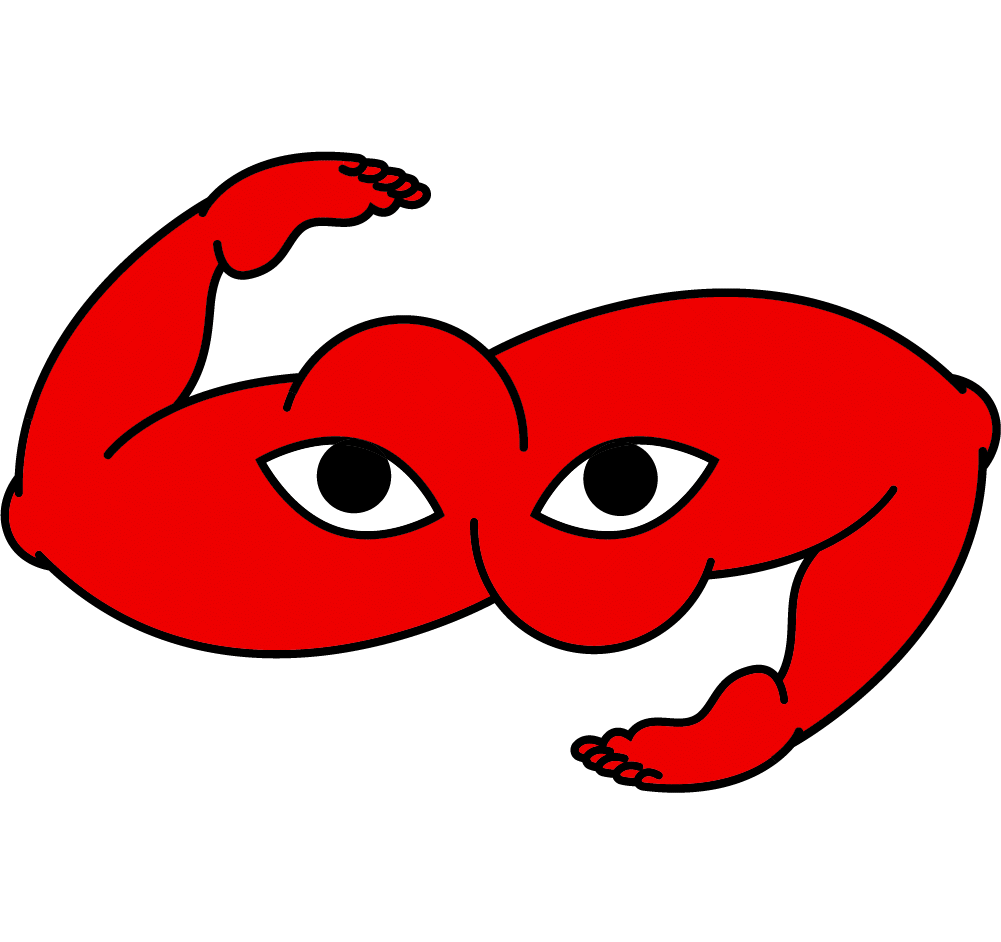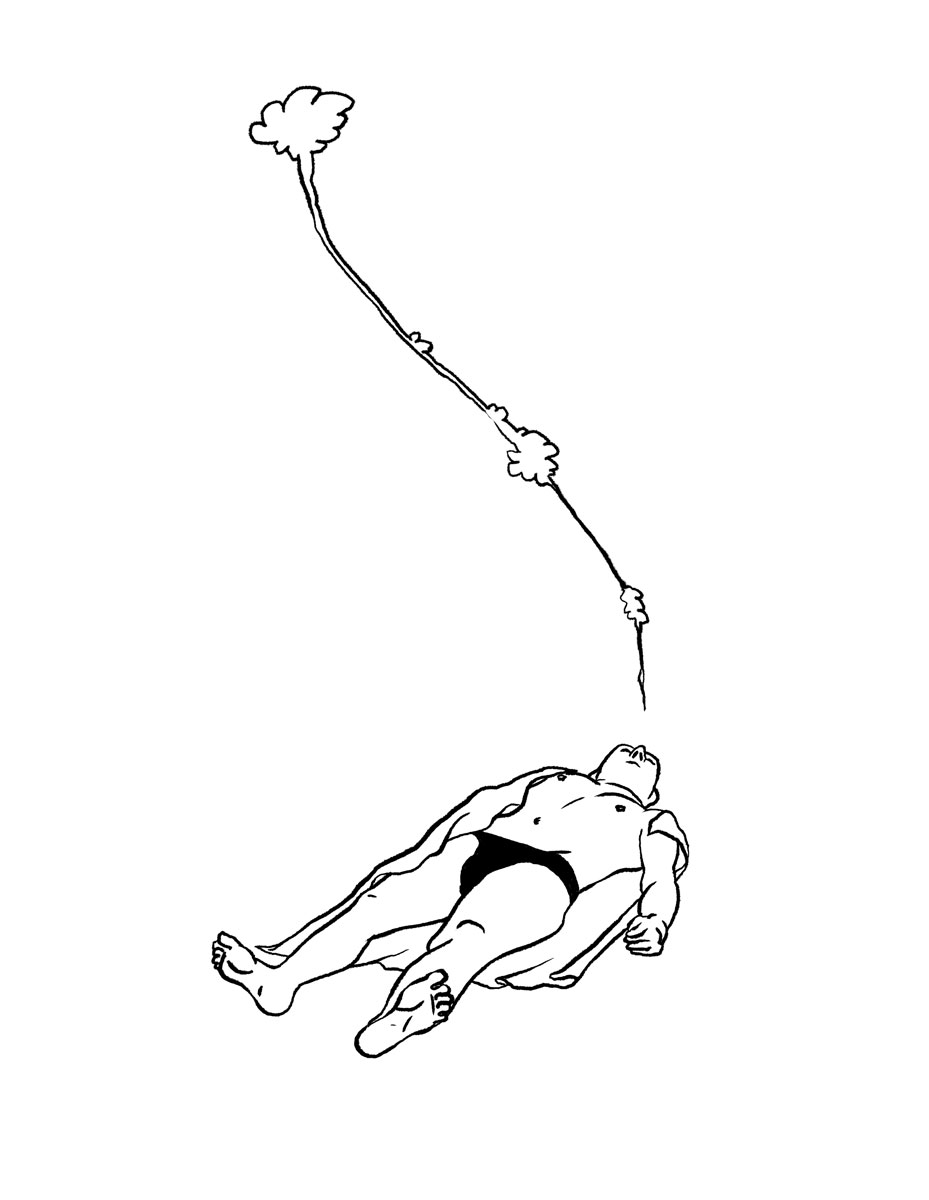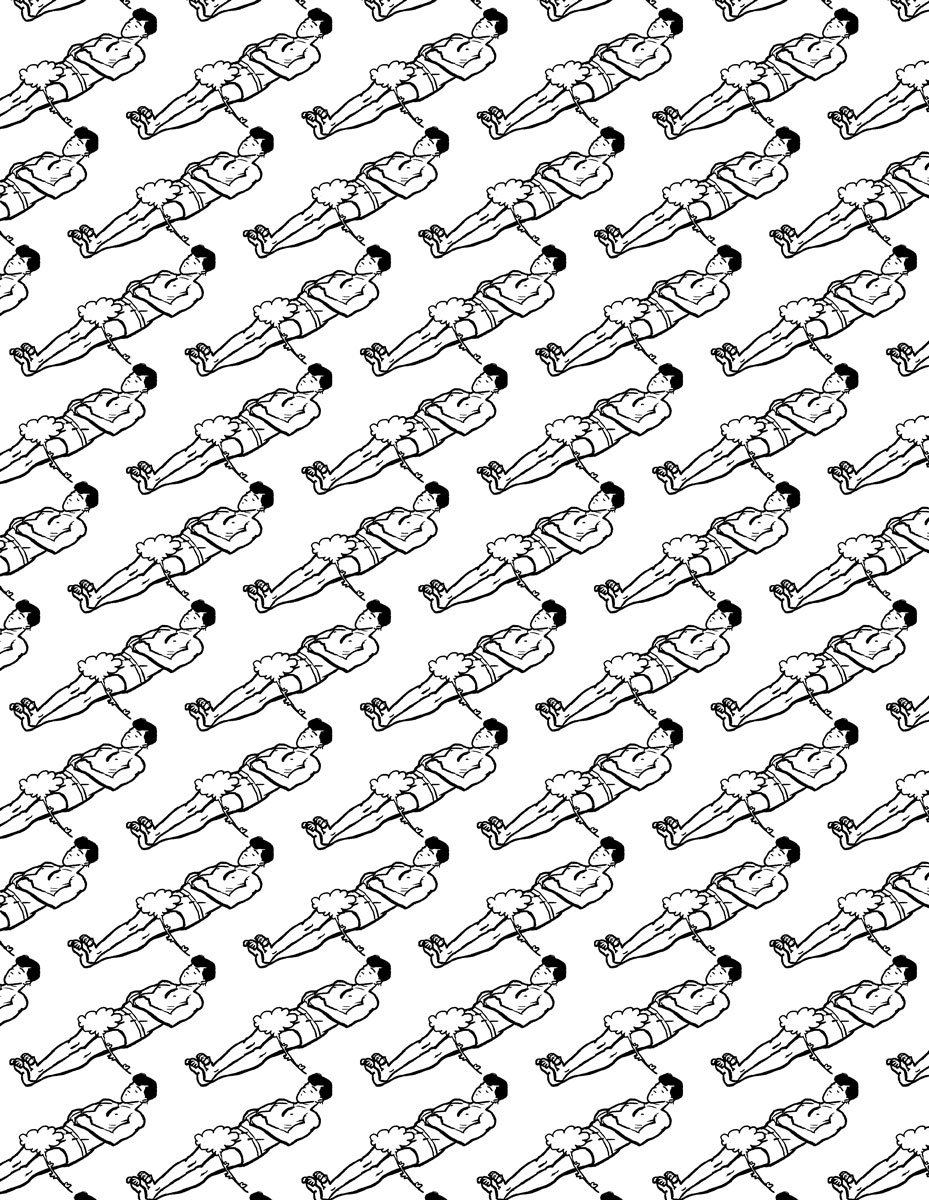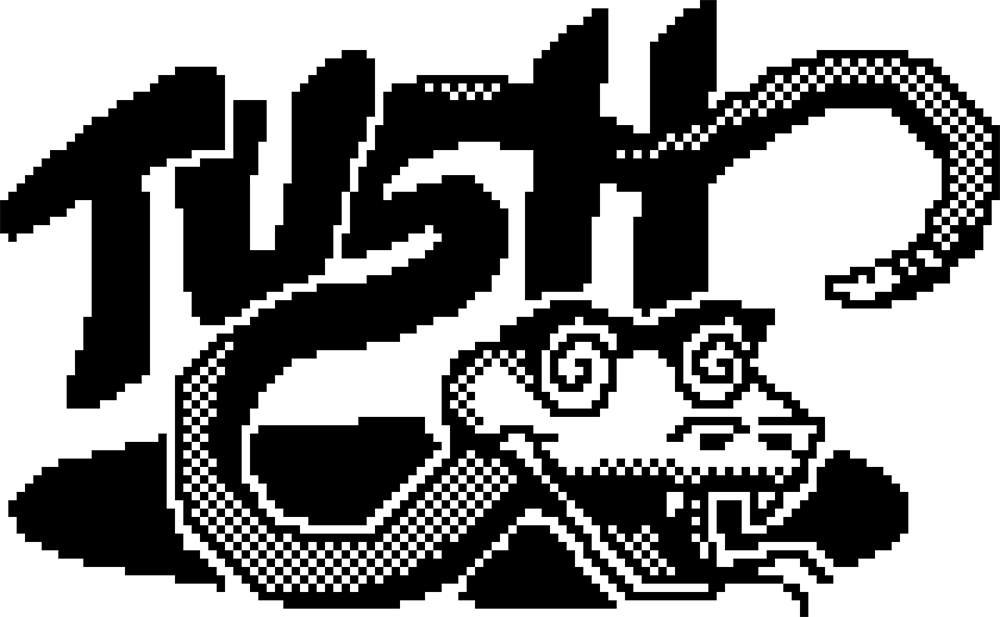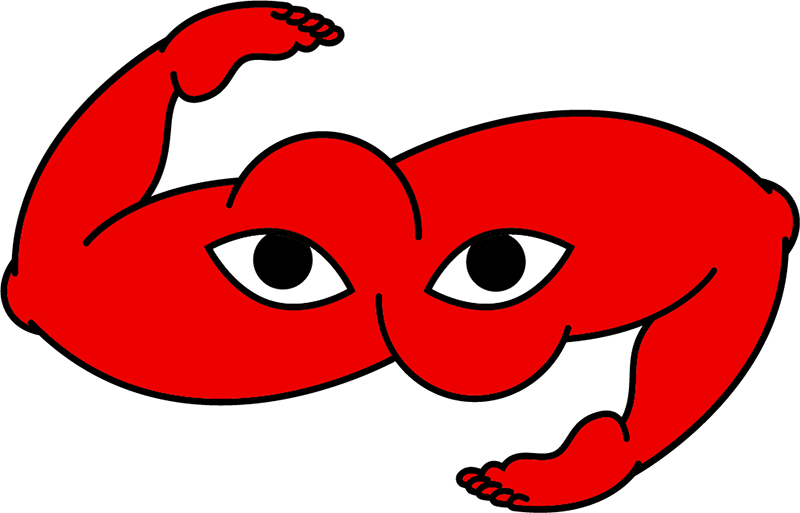Digitalisierung und Automatisierung vernichten Arbeitsplätze und damit die Grundfesten unserer Gesellschaft, heißt es. Der kanadische Ökonom Nick Srnicek sagt: Na und? Ohne Arbeit geht es uns allen besser
„Das Ziel der Zukunft ist die Vollarbeitslosigkeit“*, zitiert der kanadische Ökonom Nick Srnicek den Physiker und Schriftsteller Arthur C. Clarke, der die Vorlage zu Stanley Kubricks Filmklassiker „2001: Odyssee im Weltraum“ schrieb. Eine Gesellschaft ohne Lohnarbeit scheint uns weiterhin wie Science-Fiction, wie eine Utopie realitätsferner Hippies, wie ein Fantasma der verwöhnten Generation Y – und das, obwohl die International Labour Organization, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, voraussagt, dass 47 bis 80 Prozent der Jobs beim derzeitigen technologischen Fortschritt in den nächsten zwei Jahrzehnten ersetzt werden können. Sich darüber Gedanken zu machen, wie eine Gesellschaft ohne Arbeit aussehen soll, ist also nicht naiv-utopistisch, sondern ausgesprochen pragmatisch – es überschreitet nur irgendwie unser Vorstellungsvermögen. Aber warum eigentlich?
Ein Loblied auf die Digitalisierung
Srnicek forscht an der London School of Economics schon seit 2013 über den Zusammenhang und die Möglichkeiten einer Postarbeitsgesellschaft, die von Digitalisierung und Automatisierung bestimmt wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Theoretikern teilt er die dystopische Grundhaltung einer Welt, die unausweichlich vor dem Kollaps steht, nicht: „The future has been cancelled“, das ist es, was uns weisgemacht werden soll, beschwert er sich in seinem mit Alex Williams verfassten, vielbeachteten ersten großen Wurf „Inventing the Future: Postcapitalism and a World without Work“. In ihrem Manifest singen die beiden, sehr untypisch für einen kapitalismuskritischen Autor, ein Loblied auf die Digitalisierung: Für den Menschen unbefriedigende oder gar gefährliche Arbeiten können von Robotern übernommen werden, Social Media ermöglicht den Menschen einfache und direkte Partizipationsmöglichkeiten und die Technologisierung wesentlich umweltfreundlichere Produktionsmöglichkeiten. Wir müssen wieder groß denken, sagt Srnicek, und beklagt, dass linke Ökonomen sich immer nur überlegen, wie alte Muster neu adaptiert werden könnten. Aber die gute alte soziale Marktwirtschaft oder die Organisation in Gewerkschaften, um Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern, passt nicht mehr in eine Zeit, in der menschliche Lohnarbeit überflüssig wird. Srnicek will eine Postarbeitsgesellschaft etablieren, die auf vier Pfeilern fußt: der möglichst vollständigen Automatisierung der Arbeit, einer radikalen Reduzierung der Arbeitszeit, einem bedingungslosen Grundeinkommen und unserer Einstellung zur Arbeit als Faktor, der Lebenssinn und soziale Stellung primär definiert.
Tech-Giganten in gemeinnützige Institutionen umwandeln
Finanziert werden soll diese Gesellschaft aus dem Überschuss, den die Roboter produzieren und der gesamtgesellschaftlich verteilt wird. Die Abschaffung der Notwendigkeit von Arbeit, so sagt er, stellt die Grundfesten des Kapitalismus und unserer Gesellschaft schon jetzt in Frage, und wir müssen darauf Antworten entwickeln. Dazu gehört auch, führt Srnicek seine Thesen in „Plattform- Kapitalismus“ weiter, große Tech-Giganten wie Google oder Facebook in gemeinnützige Institutionen umzuwandeln: Das habe man im 19. und 20. Jahrhundert mit der Eisenbahn, dem großen Giganten der Industrialisierung, auch gemacht. Würden die Daten von Google anonymisiert, aber öffentlich zur Verfügung stehen, könnten zum Beispiel Grippewellen oder gar Epidemien anhand der Suchverläufe von Ärzten wesentlich besser vorhergesagt und auch behandelt werden. Sieht man sich aktuelle Tendenzen an, sind wir einstellungsmäßig von Srniceks Utopie noch ein gutes Stück entfernt: In einer im Dezember 2018 veröffentlichten Studie der ZEIT über die Wünsche deutscher Arbeitnehmer stand nicht etwa der Wunsch nach Selbstverwirklichung, Teilzeit und Sabbaticals an erster Stelle, sondern die langfristige Sicherheit des Arbeitsplatzes und die Zukunftssicherheit des Berufes an sich. Anstatt dass wir immer weniger arbeiten, arbeiten diejenigen, die einen Job haben, immer mehr und unter immer prekäreren Bedingungen oder in Jobs, die der Anthropologe David Graeber als „Bullshit-Jobs“ bezeichnet: Jobs, die völlig sinnlos sind und nur erfunden wurden, um den Menschen zu verschleiern, dass man ihre Arbeitskraft eigentlich nicht mehr braucht.